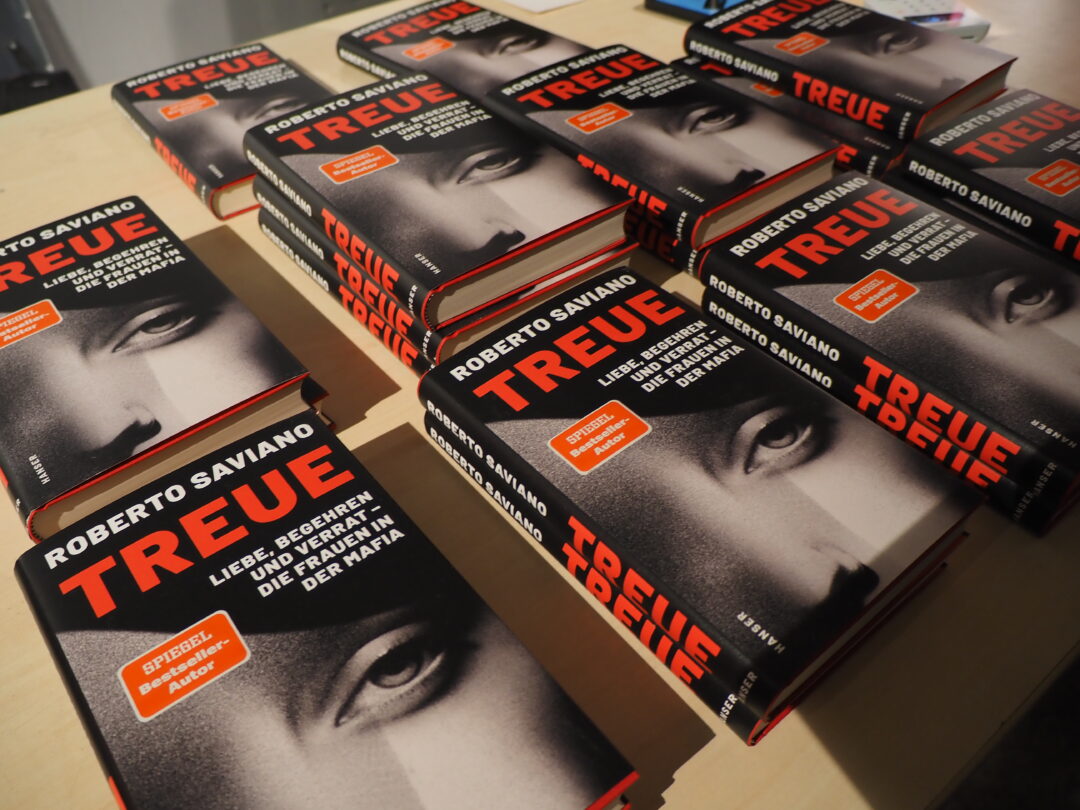Gestern sprach ich mit einer arabischen Frau, und sie sagte einen Satz, der mich tief getroffen hat: „Ich habe eine Essstörung, so wie fast alle mediterranen und nahöstlichen Frauen.“
„Warum? Was hat das mit unserer Herkunft zu tun?“, fragte ich.
Und sie antwortete: „Weil unsere Mütter ihre Zuneigung durch Essen zeigen, es ist ihr Ersatz für Liebe.“
Da wurde mir klar: Hinter der typischen Anekdote über die Großmütter aus dem Süden, die nur zufrieden sind, wenn man isst wie ein Tier, steckt mehr als nur ein Lächeln.
Dass Essstörungen eine psychologische Komponente haben, ist klar. Aber ich hatte nie darüber nachgedacht, sie geografisch in den „warmen Regionen“ zu verorten. Und doch fand ich viele Studien und Bücher, die bestätigen, dass emotionales Essen dort häufiger auftritt, wo Nahrung eine starke symbolische und emotionale Bedeutung hat.
In Kulturen, in denen meist die Frauen das Sagen in der Küche haben, in denen Mütter „Köchinnen der Liebe“ sind. Frauen, oft klug und intuitiv, aber nicht unbedingt gebildet. Frauen, die viel mehr hätten sein können als nur Mütter, und sich trotzdem auf diese Rolle beschränkt haben.
Schon als Säugling wird dir der Schnuller oder das Fläschchen in den Mund gedrückt, sobald du weinst. Später heißt es dann: „Iss alles auf, ich habe das für dich gekocht.“
Ein scheinbar liebevoller Satz, der aber oft bedeutet: „Iss, dann liebst du mich.“
In Regionen, in denen Essen Sprache der Zuneigung ist, etwa im Mittelmeerraum oder im Nahen Osten, nähren die Mütter, sie kümmern sich, sie opfern sich auf. Aber oft hören sie nicht zu. Es gibt kaum emotionalen Raum, nur Handlungen des Gebens und Füllens. So wird Essen zum Ersatz für das Gespräch, zum falschen Regler für Emotionen, der versucht, etwas zu füllen, das nicht gefüllt werden kann: die Leere im Bauch, die aus nicht-gelebten Gefühlen stammt.
Das Essen, das nährt, kann auch ersticken. Wo das Gespräch fehlt, wird die Zuneigung geschluckt, und später bekämpft. Besonders für Töchter entsteht so ein innerer Widerspruch: Zuhause hörst du „Iss, dann liebst du mich“, draußen aber sagt dir die Welt: „Sei schlank, sei kontrolliert, sei schön.“
Wenn Liebe und Nahrung verschmelzen, aber von außen Kontrolle und Dünnsein verlangt werden, wird der Körper zum Schlachtfeld zwischen Bedürfnis, Schuld und Rebellion.
Es ist kein Zufall, dass Essstörungen vor allem bei Frauen auftreten. Mädchen erhalten viel mehr Schönheitsbotschaften als Jungen. Mütter projizieren (unbewusst) ihre eigenen emotionalen Wunden auf ihre Töchter. Und Frauen lernen, Schmerz zu verschweigen statt zu zeigen. Der Körper wird so zum Behälter für das Unsagbare… und ein Behälter will gefüllt werden.
Kochen für andere ist sicher ein Akt der Liebe. Aber wie alles, was unsere Gesellschaft „Liebe“ nennt, kann es auch ein Mittel zur Kontrolle werden, indem es Raum einnimmt, keine Autonomie lässt. Vor allem in Kulturen, in denen Mutterschaft die einzige akzeptierte Form von Identität ist. Und wo Ausdrucksmöglichkeiten begrenzt sind, bleibt der Körper der einzige Ort, an dem Kontrolle ausgeübt werden kann.
Kochen kann Liebe sein, aber wenn Liebe schweigt, läuft man Gefahr, auch den Schmerz mit hinunterzuschlucken. Vielleicht sollten wir erst versuchen, diese Leere in uns zu verstehen… und dann kochen.