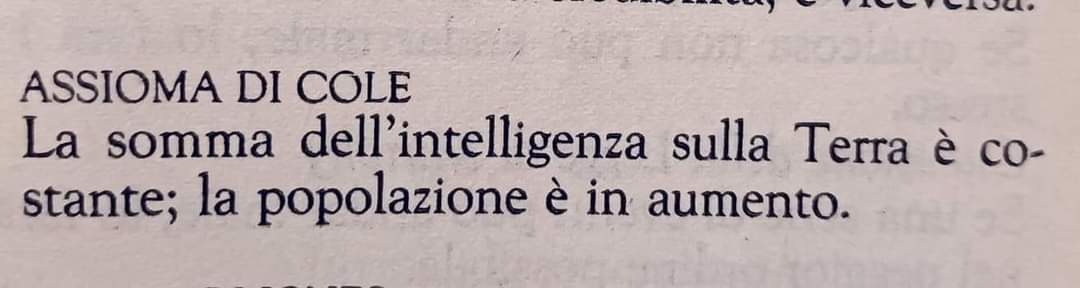Wenn wir unsere Zeit mit einem einzigen Wort beschreiben müssten, wäre es: rennen.
Und nicht rennen aus Spaß, sondern schneller rennen als die anderen.
Die globalisierte Kommunikation hält uns ständig unerreichbare Vergleichswerte vor die Augen.
Da gibt es Wunderkinder, die mit zwanzig schon zwei Abschlüsse haben, junge Olympioniken mit unglaublichen Leistungen.
Wenn du fünfundzwanzig bist und Gitarre lernen willst, zeigt dir dein Bildschirm ein achtjähriges Kind, das schon wie ein Profi spielt. Und plötzlich denkst du: „Ich bin schon zu alt, um bei null anzufangen.“
Solche Ausnahmetalente gab es natürlich auch früher, aber heute sehen wir sie jeden Tag, bei jedem Scrollen.
Und wir beginnen zu glauben, sie seien die Norm.
Dabei machen diese Talente nur einen winzigen Bruchteil der Bevölkerung aus. Sie sind völlig unrealistische Vergleichsmaßstäbe.
Und als ob das nicht genug wäre, ist das Internet überfüllt mit motivationspredigenden Gurus, Leuten, die oft noch ahnungsloser sind als du, und dir erzählen, dass du „nur wollen musst“.
Du musst einfach um fünf Uhr morgens aufstehen, zehn Kilometer joggen, meditieren, Yoga machen, drei Bücher im Monat lesen, zwanzig Stunden am Tag arbeiten, und zack, gehört dir der Erfolg.
Aber diese riesige Lüge, die sich als Inspiration tarnt, hat keinen Bezug zur Realität.
Sie berücksichtigt nicht deine persönlichen Neigungen, deine mentale Gesundheit, die Tatsache, dass der Mensch keine Leistungsmaschine ist.
Sie sagen dir: „Du hast keine Ausrede“, aber in Wirklichkeit ist das nur ein weiterer kapitalistischer Trick, um dir ein neues Schuldgefühl zu verkaufen.
Als wären Erschöpfung, Müdigkeit und Scheitern keine menschlichen Erfahrungen, sondern einfach Faulheit.
Und so beginnst du wieder, schneller zu rennen, ohne zu merken, dass das Ziel, das du dir gesetzt hast, gar nicht wirklich deins ist, es ist nur ein Standard.
Und diesem Standard ist es völlig egal, wer du bist.
Aber hinter all dem steckt eine tiefere Überlegung, die, so finde ich, mit unserer kapitalistischen Lebenswahrnehmung zusammenhängt:
Kapitalismus ist nicht nur ein Wirtschaftssystem, sondern eine Denkweise.
Er hat sich in unsere Köpfe eingeschlichen und uns glauben gemacht, dass man ein besserer Mensch ist, je mehr Fähigkeiten man hat.
So hat das Haben das Sein völlig ersetzt, wie Fromm es einst schrieb.
Wir haben vergessen, dass wir ohne Besitz geboren wurden und diese Welt auch ohne etwas im Gepäck verlassen werden.
Wir haben vergessen, dass man Dinge lernen sollte, nicht nur um Geld zu verdienen, sondern um sich als Mensch zu entwickeln.
Sogar unsere Freizeit ist zur versteckten Produktivität geworden.
Wir sollten Gitarre für uns selbst spielen, und tun es doch, um anderen etwas zu beweisen, um besser zu sein als jemand anders.
Neulich hörte ich einen bekannten Psychiater, der David Bowie zitierte: „Never play for the audience.“
Wenn man diesen Satz auf alle Lebensbereiche überträgt, merke ich: Ich kenne nur sehr wenige Menschen, die nicht fürs Publikum spielen. Und meistens sind genau diese Menschen zufriedener als der Durchschnitt.
Leistung steht immer über Freude, über Langsamkeit, über dem Tun um des Tuns willen.
Aber sind wir wirklich dafür gemacht, ständig mehr zu erreichen?