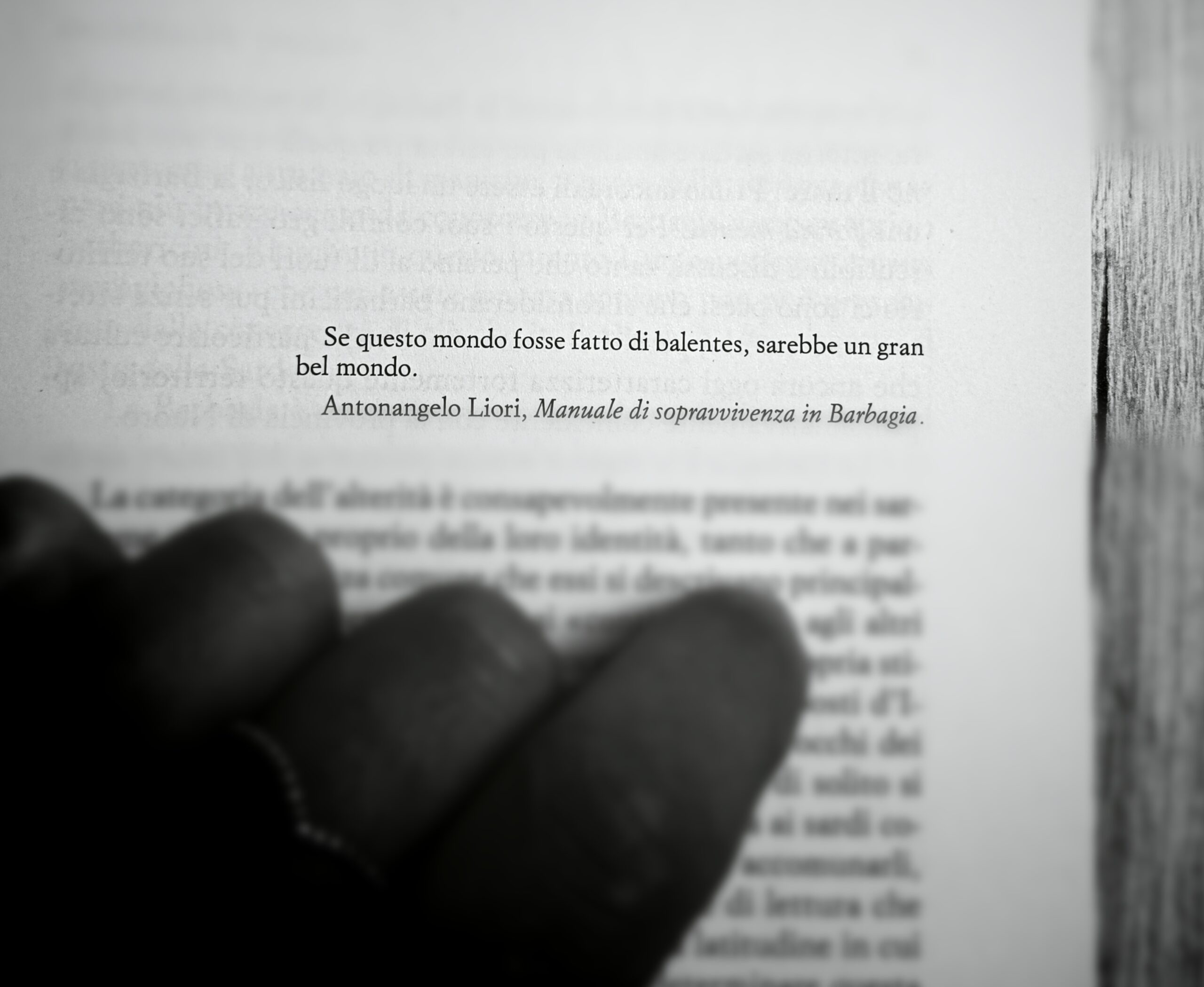Art.1. – Die Beleidigung muss gerächt werden.
Kein Mann von Ehre entzieht sich der Pflicht zur Rache, es sei denn, er hat mit seinem Leben seine Männlichkeit bewiesen und verzichtet darauf aus einem höheren moralischen Grund. (Antonio Pigliaru, Der Kodex der barbaricinischen Rache)
Das Wort „homine“ bedeutet auf Sardisch nicht nur „Mann“ im biologischen Sinne, sondern beschreibt einen starken, geschickten Mann, der Herausforderungen mit seinen Fähigkeiten und seiner Aggressivität meistert. Einen Mann, der Respekt einfordert und tugendhaft ist. Einen Mann, der ein „balente“ ist.
Früher war der barbaricinische sardische Hirte, s’homine balente, die unangefochtene Hauptfigur einer isolierten Realität, die innerhalb Sardiniens ebenso einzigartig wie unglaublich war: der Barbagia. Ein bergiges, raues Hirtengebiet. Eine Insel innerhalb einer Insel mit einem eigenen Kodex, genannt der Kodex der barbaricinischen Rache. Es ist unklar, wann und wie er entstanden ist, aber er ist uralt, seine Wurzeln reichen wahrscheinlich bis in die vorrömische Zeit zurück.
Obwohl er heute fast ausschließlich negativ gesehen wird, hatte die Rache in der Barbagia eine entscheidende Funktion: Sie garantierte das soziale Gleichgewicht in Abwesenheit einer zuverlässigen und angemessenen Staatsgewalt.
Rache mit sozialem Gleichgewicht zu verbinden, mag widersprüchlich erscheinen. Doch genau so funktionierte es: Da die staatliche Justiz versagte (wie es auch heute oft der Fall ist) und da sie den Regeln der sardischen Hirtenwelt völlig fremd und feindlich gegenüberstand, war jeder verpflichtet, selbst für Gerechtigkeit zu sorgen. Dies stellte sicher, dass soziale Beziehungen von einem gemeinsamen Regelwerk zusammengehalten wurden, das der Gemeinschaft Stabilität verlieh, die sie sonst verloren hätte. Gleichzeitig bewies es der Gemeinschaft, dass man kein schwacher Mensch war.
Wenn ein Hirte Schwäche zeigte, verlor er nämlich seine Glaubwürdigkeit (die sogenannte Ehre), und er und seine Familie liefen Gefahr, weiteren Angriffen ausgesetzt zu werden. So erzog diese Welt Kinder zu starken, rachsüchtigen und äußerst verantwortungsbewussten Menschen (mein Großvater schlief mit sieben Jahren bereits allein auf dem Land, um seine Herde zu bewachen, die sonst Opfer von Viehdiebstahl geworden wäre). Ebenso wuchsen Frauen stark und einschüchternd auf. In einer feindlichen Region wie der Barbagia war das Ziel, stark und geschickt zu sein, nicht die Vorherrschaft über andere, sondern eine zuverlässige Person zu sein, ein stabiles Element in einem aktiven sozialen Netzwerk. In der Hirtenwelt waren Einsamkeit und die Herausforderungen der Natur gigantische Hindernisse , Hindernisse, denen nur ein „balente“ standhalten konnte.
Es ist wichtig zu betonen, dass die barbaricinische Rache kein impulsiver oder chaotischer Akt war, wie in kriminellen Organisationen, sondern eine zwingende und vorhersehbare Handlung mit klar definierten Grenzen. Sie war ein regulierter Akt, der durch präzise soziale Normen bestimmt wurde, die von allen akzeptiert wurden. Wenn jemand deine Herde stahl, durfte man nicht mit einem Mord antworten. Ein Mord wurde mit einem Mord in gleichem Maße vergolten, keine Massaker. In manchen Fällen griff ein Vermittler ein, um Blutvergießen zu verhindern. Frauen, Kinder und Unschuldige durften nicht berührt werden: Die Rache traf nur die direkt Beteiligten.
Alle Mitglieder der Gemeinschaft teilten diese Regeln, weshalb dieser Kodex paradoxerweise Chaos verhinderte und, noch paradoxer, wahllose Gewalt eindämmte (im Gegensatz zur Mafia). Vor allem sorgte er dafür, dass niemand seine Macht missbrauchte, denn in einer Welt der „balentes“, in der sich jeder selbst rächt, überlegt man es sich zweimal (oder dreimal), bevor man jemandem Schaden zufügt.
Niemand hat diesen Kodex je schriftlich festgehalten, er wurde über Jahrhunderte mündlich weitergegeben (daher auch der Name „ungeschriebener Kodex“). Niemand, bis 1959, als Antonio Pigliaru beschloss, eine echte juristische Ordnung basierend auf der barbaricinischen Rache niederzuschreiben: eine Liste von 26 Artikeln, die die Seele der barbaricinischen Hirtenwelt präzise darstellt.
Mein Großvater, selbst seit 88 Jahren Hirte, hatte Pigliarus Buch nie gelesen. Aber als ich ihn fragte, was er tun würde, wenn ihm seine Herde gestohlen würde, antwortete er genau so, wie er antworten musste:
„Ma sì mi urana sa roba, non bi ando a caserma a los dennunziare. Bi la uro jeo puru“ -„Wenn sie mir die Herde stehlen, gehe ich sicher nicht zur Polizei, um sie anzuzeigen. Ich stehle sie zurück.“
Dass dieser Kodex den Staatsgesetzen widerspricht, ist offensichtlich. Doch es ist wichtig zu betonen, dass der sardische Banditismus kein direktes Produkt des barbaricinischen Kodex war, sondern eine seiner Nebenerscheinungen. Die Gesetze der Hirtenwelt kollidierten mit denen des Staates, der sie nicht verstand und nie ein wirklich effektives alternatives Modell anzubieten wusste (oder in anderen Worten: „non nde achene, e non nde dassan fachere“ – „Sie tun nichts, und sie lassen nichts tun.“)
Aber heute? Wo sind all diese Regeln und Gewissheiten geblieben?
Heute sind vom barbaricinischen Kodex nur noch verworrene Fragmente übrig. Vereinzelte, ungeordnete Reste.
Die einst kohärente Ordnung ist verschwunden und hat nur eine dünne Staubschicht hinterlassen, die sich, nicht zufällig, in den rauesten Gebieten der Insel niedergelassen hat.
In vielen Gebieten des Inneren gibt es Gruppen von jungen und älteren Männern, die dem längst vergangenen Mythos des „balente“ folgen und eine widerständige, aber verwirrte Linie vertreten. Dass sie Widerstand leisten, ist gut. Dass sie verwirrt sind, weniger: Sie rebellieren gegen das Gesetz, gegen Carabinieri und Polizei, benehmen sich wahllos wie Gesetzlose, sie schießen auf Festen, verstricken sich in Drogengeschäfte, zücken das Messer wegen eines falschen Blicks, ohne genau zu wissen, warum. Die Mutigeren haben das instinktive Bedürfnis, die Regeln des Staates herauszufordern, doch sie wissen nicht genau, wogegen sie kämpfen. Es ist ein tief verwurzeltes (und verständliches) Misstrauen gegenüber dem Staat und all seinen Institutionen, geerbt, ohne die Wurzeln zu verstehen.
Ich sage „leider“, weil Widerstand, wenn er gut gelenkt wird, eine positive Kraft ist. Aber Widerstand ohne Verstehen, ohne klare Botschaften, hält uns in der selben Falle gefangen, in die wir uns aus Notwendigkeit immer wieder selbst eingesperrt haben: Wir verweigern uns dem Lernen aus der Vergangenheit, aber öffnen uns auch nicht der Gegenwart. So beobachten wir nur die Schatten der Realität, ohne je wirklich Teil von ihr zu sein.
Dabei sollte Geschichte genau das leisten: Uns helfen zu verstehen, wer wir sind, und uns lehren, mit Klarheit zu widerstehen.